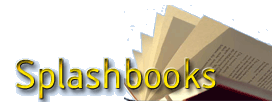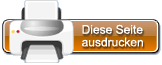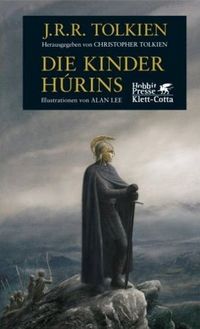Die Kinder Húrins
Story:
Im Ersten Zeitalter von Mittelerde, als Beleriand noch nicht vom Meer überflutet war, versucht der gefallene Gott Morgoth die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen. Zwar können Elben und Menschen ihn einige Jahrhunderte in seiner Festung Angband einschließen. Aber die Macht des Feindes bricht sich schließlich doch in Gestalt von Feuerstürmen und endlosen Strömen von Orks und anderen Kreaturen Bahn.
Nach der Schlacht der Ungezählten Tränen sind viele der größten Helden tot, und den anderen bleiben nur wenige Rückzugsorte. Informationen darüber, wo einer davon verborgen ist, erhofft sich Morgoth von dem Menschenfürsten Húrin. Aber der in der Schlacht gefangene Held gibt sein Wissen nicht preis. Daraufhin belegt ihn der ehemalige Valar mit einem Fluch, der nicht nur Húrin selbst ins Unglück stürzen soll, sondern auch dessen gesamte Familie.
Gelingt es Húrins kleinem Sohn Túrin, gerade einmal acht Jahre alt, Morgoths Zorn zu entkommen? Dem jungen Helden stehen viele Abenteuer bevor, viele Siege, aber auch Niederlagen und tragische Verluste.
Meinung:
Der Name J. R. R. Tolkien hat einen Klang wie kaum ein anderer in der fantastischen Literatur, und ein neues Buch aus der Feder des Meisters wird von vielen heiß ersehnt. Allerdings war hier noch ein anderer Tolkien beteiligt: Christopher Tolkien, der Sohn des Autors, hat nicht abgeschlossene Teile und Fragmente aus dem Nachlass zu einer Geschichte zusammengefügt.
Erzählt wird hier die Geschichte um Túrin, seine Schwester Nienor und all die anderen, die zu Zeiten des "Herrn der Ringe" längst Legende geworden sind. Und Legende ist auch der passende Begriff, um den Erzählstil in Die Kinder Hurins zu beschreiben. Besonders die ersten Kapitel fühlen sich an wie am Lagerfeuer erzählt, wie Berichte aus längst vergangener Zeit. Der erzählerische Fokus, der den Blick des Lesers lenkt, bleibt zu Beginn oft grob, auf die großen Linien konzentriert. Die Figuren agieren weniger auf der literarischen Bühne, dem Leser wird eher von ihrem Agieren berichtet. Wochenlange Reisen, sogar jahrelange Suchen werden in wenigen Worten abgehandelt. Als Túrin nach dem Verlust eines geliebten Freundes wahnsinnig wird, ist das schnell berichtet, und einige Absätze später ist die Verdunklung seines Geistes auch schon wieder geheilt.
Das führt dazu, dass der Leser zunächst kaum eine Beziehung zu den Figuren aufbauen kann. Man erlebt sie kaum, man lebt kaum mit ihnen, man bekommt mehr von ihren Erlebnissen zusammengefasst berichtet. Dazu tragen auch einige andere Aspekte des Romans bei: Tolkien verankert die Geschichte sorgfältig und ausführlich im gesamten Kosmos von Mittelerde. Der Leser wird mit den Namen unzähliger Personen, Orte und Ereignisse konfrontiert, die – nach einschneidenden Geschehnissen – auch schon einmal wechseln. Allein Túrin selbst trägt gleich vier oder fünf weitere Namen, mal zur Tarnung auf seinen Reisen, mal zur Erinnerung an seine Taten. Ein "Tolkien-Neuling" könnte mit den Kindern Húrins durchaus überfordert sein. Dadurch werden die Zusätze, die dem Buch spendiert wurden, um so wichtiger, darunter eine Einführung in die Geschichte Mittelerdes in den Ältesten Tagen, Stammbäume, eine ausklappbare Karte und Anmerkungen von Christopher Tolkien zur Zusammenstellung des Textes. Auch die Kapiteltitel, die oft etwas zu viel vorwegnehmen, haben ihre Auswirkungen: Erfährt der Leser schon im Titel, das eine Figur sterben, eine Stadt untergehen wird, mindert das die Spannung und das Mitgefühl doch merklich.
Aber nach den ersten Kapiteln treten diese Probleme in den Hintergrund, und vor allem der "entfernte" Erzählstil nähert sich immer mehr dem an, was seine Fans von J. R. R. Tolkien gewöhnt sind. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass Christopher Tolkien Texte, Fragmente und Entwürfe aus ganz unterschiedlichen Schaffensperioden seines Vaters für dieses Buch verwendet hat. Die ersten Anlagen für die Kinder Húrins und andere Geschichten gehen bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück, während die späteren Teile, vor allem der Kampf gegen den Drachen Glaurung, erst in den 1950ern nach dem Abschluß des Herrn der Ringe entstanden. Wie dem auch sei, spätestens im letzten Drittel bietet das Buch wieder fantastische Literatur, in beiderlei Wortbedeutung.
Dann wird dem Leser auch der tragische Held, um nicht zu sagen Anti-Held Túrin ein wenig sympathisch. Für eine Rolle als Sympathieträger ist er nämlich einerseits zu perfekt von Gestalt und als Krieger, andererseits – man entschuldige den Ausdruck – in seinem übermäßigen Stolz und regelmäßigen Wutausbrüchen ein regelrechtes Arschloch. Aber je mehr man zu ahnen beginnt, in welches Verderben er und seine Schwester, sei es durch Morgoths Fluch, Schicksal oder den eigenen Charakter, getrieben werden, desto mehr möchte man sie davor bewahren. Und auch Túrin ändert sich im Lauf der achtzehn Kapitel.
Insgesamt liegt hier kein neuer Rivale für den Herrn der Ringe vor. Aber neben diesen Bänden, dem Kleinen Hobbit, dem Silmarillion und den anderen Werken Tolkiens ist auch "Die Kinder Húrins" im Bücherregal gut aufgehoben.
Fazit:
Nach einem schwächeren Beginn zeigen sich die Kinder Húrins als durchaus würdig, neben den anderen Werken Tolkiens im Regal zu stehen. Tolkien-Neulinge müssen sich durch einen heute unüblichen, zu Beginn sehr weitgreifenden Erzählstil und viele Namen und Verbindungen zu anderen Geschichten aus Mittelerde arbeiten, werden aber am Ende belohnt.
|  |
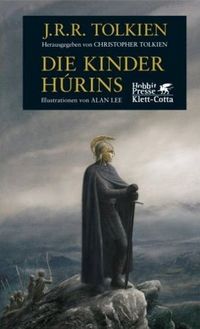
J. R. R. Tolkien, Christopher Tolkien (Hrsg.)
Die Kinder Húrins
The Children of Húrin
Übersetzer: Hans J. Schütz, Helmut W. Pesch
Erscheinungsjahr: 2007
Autor der Besprechung:
Henning Kockerbeck
Verlag:
Klett-Cotta
Preis:
€ 19,90
ISBN:
978-3-608-93603-2
334 Seiten
|