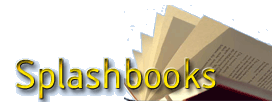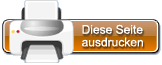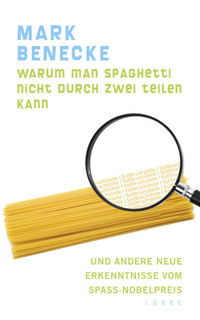Warum man Spaghetti nicht durch zwei teilen kann
Story:
Wenn Nudeln in Schwingungen geraten, Schwimmbecken mit Glibber gefüllt werden, Menschen im Liegen Anagramme entschlüsseln oder Suppenteller wie magisch niemals leer werden, könnte Wissenschaft im Spiel sein. Der bekannte Kriminalbiologe Mark Benecke hat in diesem Band erneut einige der erstaunlichsten Arbeiten, die für die "alternativen Nobelpreise" eingereicht wurden, zusammengestellt.
Meinung:
Es gibt nichts, womit sich nicht schon mal irgendwo ein Wissenschaftler beschäftigt hätte. Diesen Eindruck kann man jedenfalls gewinnen, wenn man sich die Reihe der Bücher betrachtet, die teils erstaunliche, teils faszinierende, in der Regel aber vor allem lustige Fundstücke aus den Archiven des "alternativen Nobelpreises" vorstellen. In seinem Band "Lachende Wissenschaft" hatte Mark Benecke bereits über fünfzig solcher Forschungsarbeiten ausgewählt, in diesem Buch macht er gerade weiter. Und es wirkt keineswegs so, als würde er hier sozusagen die Reste verbraten. Ob es um Rückschlüsse aus dem Detailreichtum von Kontaktanzeigen geht, um mozarthörende Karpfen oder um (doch nicht so) enthaltsame Jugendliche und Geschlechtskrankheiten, in "Warum man Spaghetti nicht durch zwei teilen kann" wird ordentlich was geboten.
Dabei hat jede Geschichte wenigstens eine Stück weit einen ernsthaften wissenschaftlichen Hintergrund. Die Titelgeschichte widmet sich etwa der Frage, warum Spaghetti niemals in zwei, sondern grundsätzlich immer in mehr Einzelteile zerbrechen. Die Lösung liegt in Schwingungen, in die man die Teilwaren beim Brechen versetzt, die dann an den Enden der Nudel reflektiert werden und beim "Zurückschwingen" zu weiteren Bruchstellen führen. Aus diesen Ergebnissen lassen sich Erkenntnisse über das Verhalten von Wolkenkratzern oder Brücken im Wind gewinnen. Bei anderen Themen, wie der Beschallung von Fischen mit Mozart, ist der "wirkliche" Nutzwert weniger augenfällig.
Nicht zu übersehen ist der typische Humor, mit dem Benecke die Geschichten präsentiert. Er schafft es auch in diesem Buch, sein Thema mit viel Augenzwinkern und ohne Bierernst zu schildern, ohne dabei Abstriche im Bezug auf das wissenschaftliche Denken zu machen. Wer den Kriminalbiologen vor allem im Zusammenhang mit grausamen Morden, blutigen Leichen und Fliegenmaden kennt, braucht hier nichts dergleichen zu befürchten. Nicht alle Kapitel mögen in jeder Gesellschaft ein gutes Tischgespräch abgeben – wie etwa die Frage, warum ausgerechnet Jugendliche, die öffentlich Enthaltsamkeit bis zur Ehe geschworen haben, überproportional häufig an Geschlechtskrankheiten leiden –, aber so wirklich gruselig oder eklig wird es nie.
Allerdings tritt der Ermüdungseffekt, der sich schon bei Beneckes vorherigem Band zeigte, diesmal früher auf: Wer schon "Lachende Wissenschaft" oder einige der inzwischen zahlreichen weiteren Bücher anderer Autoren zum gleichen Thema gelesen hat, wird vermutlich etwas weniger Freude an diesem Band haben. Irgendwann ist man einfach überfüttert mit ungewöhnlichen, aber amüsanten Forschungsideen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man dann "Warum man Spaghetti nicht durch zwei teilen kann" nicht lesen sollte. In beispielsweise täglichen Häppchen eingenommen dürften auch "erfahrene" Leser ihren Spaß an den Geschichten haben. Und dann ist man mit diesem Buch immerhin rund eineinhalb Monate versorgt.
Fazit:
Mark Benecke präsentiert weitere Fundstücke aus dem offenbar schier unerschöpflichen Fundus der "alternativen Nobelpreise". Wie schon in seinem vorherigen Band zum selben Thema versteht er es, eine reichliche Portion Humor und wissenschaftliche Korrektheit unter einen Hut zu bringen. Wer aber schon "Lachende Wissenschaft" oder einige der anderen inzwischen zahlreichen Bücher zum gleichen Thema gelesen hat, sollte diesen Band lieber in Etappen genießen, da sonst schnell ein Übersättigungseffekt auftritt.
|  |
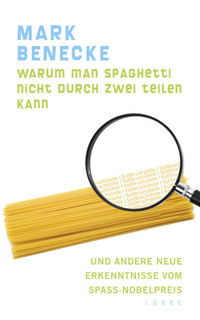
Mark Benecke
Warum man Spaghetti nicht durch zwei teilen kann
Erscheinungsjahr:
Autor der Besprechung:
Henning Kockerbeck
Verlag:
Bastei Lübbe
Preis:
€ 14,50
ISBN:
978-3-7857-2368-5
253 Seiten
|