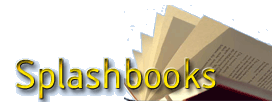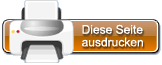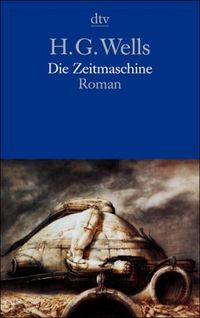Die Zeitmaschine
Story:
Ein Namenloser berichtet seinem Freundeskreis gegen Ende des 19. Jahrhunderts von seiner Erfindung: einer Zeitmaschine. Mit diesem als Vehikel gebautem Gerät kann er auf der Zeitachse, beziehungsweise in der vierten Dimension, vor und zurück reisen. Sein erster Versuch bringt ihn, mehr oder weniger willentlich, in das weit entfernte Jahr 802701. Zwar sprechen die Lebewesen inzwischen eine andere Sprache, aber der Zeitreisende kann dennoch Einzelheiten über die Zukunft erfahren. Die gesellschaftlichen Klassen, die der Zeitreisende aus seinem viktorianischen England kannte, haben sich in dieser Zukunftswelt zu zwei unterschiedlichen Rassen entwickelt: die „Eloi“ und die „Morlocken“.
Die „Eloi“ erscheinen zunächst für den Zeitreisenden als zwar kleine, aber dafür sorgenfreie und äußerlich jung gebliebene Menschen. Sie müssen nicht arbeiten und scheinen stets glücklich zu sein. Doch bei genauerer Betrachtung entdeckt der Namenlose, dass sich die „Eloi“ als degeneriert und als ängstlich gegenüber der Dunkelheit und dem Unterirdischen erweisen.
Der Grund für die Angst vor der Nacht liegt bei den „Morlocken“. Diese Lebewesen sind äußerlich furchteinflößend und haben viele menschliche Züge durch ihre unterirdische Arbeit an riesigen Maschinen bereits verloren. Bei ersten Nachforschungen denkt der Zeitreisende, dass die „Morlocken“ die Sklavenarbeit für das Leben der „Eloi“ verrichten. Doch auch hier irrt sich der Namenlose. Denn er macht eine perfide Entdeckung.
Meinung:
Mit „Die Zeitmaschine“ von 1902 („The Time Machine“, 1895) hat H.G. Wells die moderne Science-Fiction begründet. Zusammen mit Jules Verne sorgte der Schriftsteller dafür, dass sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein neues Genre herausbilden konnte. Mit seinem Roman lieferte er die Vorlage, die fortan als Inspiration für zahlreiche Autoren, Zeichner und Filmemacher diente.
Wells verstand es in seinem Zeitreise-Roman auf geschickte Weise, Gesellschaftskritik mit wissenschaftlicher Vision derart zu verknüpfen, dass ein unterhaltsames und spannendes Buch dabei entstanden ist. Die soziologischen Elemente des Romans zeichnen ihn gleichzeitig als einen der ersten Dystopien beziehungsweise Gegenutopien aus, auf dem wiederum die großen Anti-Utopisten des 20. Jahrhunderts (Jewgenji Zamjatin „Wir“, George Orwell „1984“, Aldous Huxley „Schöne neue Welt“) zurückgriffen.
Sicherlich kommt dem Autor seine Ausbildung als Wissenschaftler zugute. Denn bevor er sich für ein Leben als freier Schriftsteller entschied, studierte er Physik, Chemie, Geologie, Astronomie und Biologie. Ein weiterer Aspekt aus Wells‘ Biographie, der in „Die Zeitmaschine“ mit hineinfließt, ist seine Erfahrung als Lehrling in einer Tuchfabrik, die schließlich erheblichen Anteil zu seinen Ansichten über soziale Ungerechtigkeit hatte.
Die visionäre Kraft von „Die Zeitmaschine“ lässt sich nicht zuletzt daran messen, dass sich Wissenschaftler, wie Albert Einstein und Stephen Hawkings, auf Grundlage des Buchs mit der physikalischen Möglichkeit der Zeitreise befassten.
Fazit:
Schlichtweg ein Meisterwerk und Meilenstein vom Vater der Science-Fiction und Anti-Utopie.
|  |
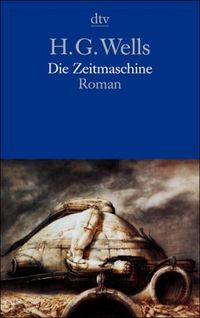
H. G. Wells
Die Zeitmaschine
The Time Machine
Übersetzer: Annie Reney
Erscheinungsjahr: 1996
Autor der Besprechung:
Marco Behringer
Verlag:
dtv
Preis:
€ 7,90
ISBN:
342312234X
148 Seiten
|